Also eine Stahlkugel aus einem Kugellager nehmen. Das in ein senkrechtes Messingrohr (Messing weil Alu das Magnetfeld streut) mit minimal grösserem Aussendurchmesser schieben und das Messingrohr vorne verjüngen. Darum eine Spule wickeln und schauen ob die Stahlkugel angehoben wird...








 Zitieren
Zitieren






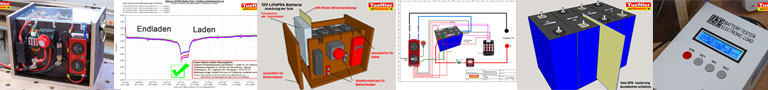
Lesezeichen